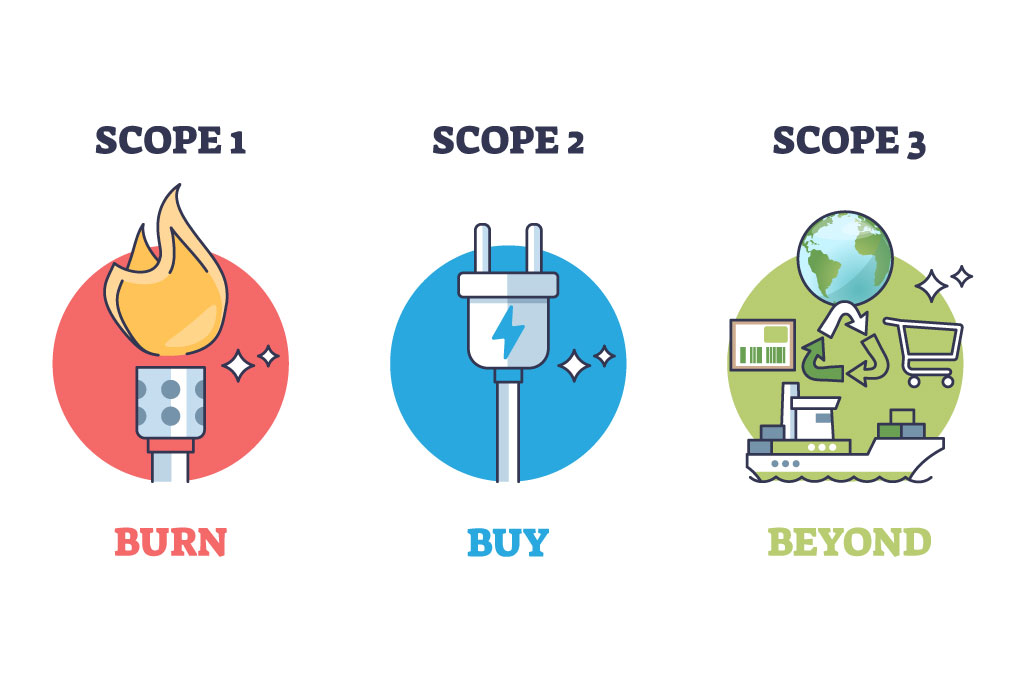Herausforderungen und Best Practices für eine erfolgreiche Datenmigration
Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloud-basierte PLM-Systeme, um ihre Produktentwicklungsprozesse effizienter zu gestalten. Unabhängig davon, ob sie bereits ein On-Premises-PLM-System nutzen und auf eine Cloud-Lösung umsteigen möchten oder erstmals ein Cloud-PLM-System implementieren: Eine der größten Herausforderungen dabei ist die reibungslose und sichere Migration von Datenbeständen.
Wie lassen sich diese Daten zuverlässig in das neue System überführen? In diesem Blogbeitrag beleuchten wir die Herausforderungen und Best Practices für eine erfolgreiche Datenmigration in Cloud-PLM-Systeme und geben Ihnen Tipps, wie Sie den Übergang effizient und ohne Datenverluste gestalten.
Welche Herausforderungen entstehen bei der Datenmigration in Cloud PLM-Systeme?
Bei der Migration von Daten in Cloud PLM-Systeme können Hürden auftreten, die den gesamten Prozess erschweren und verzögern:
1. Datenqualität und -konsistenz
Altdaten sind oft unvollständig oder inkonsistent. Fehlende Attribute, ungültige Werte oder doppelte Datensätze können den Migrationsprozess behindern. Besonders bei CAD-Modellen führen fehlende Dateien oder gebrochene Referenzen dazu, dass sich Modelle nicht vollständig importieren lassen.
2. Datenumfang und -komplexität
Je nach Umfang und Komplexität der zu übertragenden Daten kann der Migrationsprozess sehr zeitaufwändig sein. Große Datenmengen wie komplette Versionsketten von CAD-Daten oder Stücklisten mit vielen Hierarchiestufen erfordern erhebliche Rechenressourcen und verlangsamen gegebenenfalls die Migration.
3. Strukturunterschiede zwischen Systemen
Die Datenstruktur im neuen Cloud-PLM-System kann sich von der in Ihrem Altsystem unterscheiden. Möglicherweise sind Attribute, Datenfelder oder Beziehungen zwischen Datensätzen unterschiedlich organisiert, weshalb Daten vor dem Import transformiert oder neu strukturiert werden müssen.
4. Technische Herausforderungen
Die Migration von Daten in ein Cloud-System bringt spezifische technische Fragen mit sich. Beispielsweise müssen neben der Kompatibilität der Dateiformate ausreichend hohe Netzwerkbandbreiten und Datentransferraten sichergestellt werden.
5. Sicherheits- und Compliance-Anforderungen
Bei der Übertragung sensibler Daten in die Cloud sind strenge Sicherheits- und Compliance-Richtlinien einzuhalten. Daten müssen verschlüsselt transportiert und gespeichert werden, außerdem gelten Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO.
Welche zentralen Fragen sollten Sie im Vorfeld der Datenmigration klären?
Die Migration von Altdaten wird oft unterschätzt, obwohl sie eine der kritischsten Aufgaben ist, bevor ein neues PLM-System live geschaltet wird. Um Ihre Bestandsdaten erfolgreich zu importieren, sollten Sie frühzeitig eine Reihe von Fragen klären.
Zunächst müssen Sie festlegen, welche Datenobjekte in das neue System übertragen werden: Handelt es sich um CAD-Baugruppen, Teile und Stücklisten, Office-Dokumente oder Projekte? Zudem ist es wichtig, den Umfang der Daten zu bestimmen: Wollen Sie Daten aus einem bestimmten Projekt, einem Produkt, einem spezifischen Unternehmensstandort oder das gesamte Datenarchiv migrieren?
Ebenso sollten Sie klären, in welchem Umfang Sie historische Daten migrieren wollen. Möchten Sie nur die neueste Version übertragen oder alle Versionen inklusive des vollständigen Audit-Trails und der Konstruktionsänderungen? Diese Aspekte sind von zentraler Bedeutung, da sie den Umfang und die Komplexität der Migration beeinflussen.
Auch der Inhalt der Daten selbst sollte genau betrachtet werden. Überlegen Sie, ob alle Attributwerte und CAD-Parameter benötigt werden oder ob es ausreicht, nur einen Teil davon zu importieren. Dies ist wichtig, um zu definieren, welche Daten in welchen Objekten und Attributen im Ziel-PLM-System gespeichert werden sollen.
Was macht die Datenübertragung in CIM Database Cloud so einfach?
1. Benutzerfreundliche Import-Tools
Das cloud-basierte PLM-System CIM Database Cloud bietet leistungsstarke, einfach zu bedienende Import-Tools, die speziell darauf ausgelegt sind, den Migrationsprozess zu vereinfachen. Sie ermöglichen es Ihnen, Konfigurationsdaten wie Feldauswahlwerte (z.B. Dropdown-Felder) sowie PLM-Daten wie CAD-Dokumente, Teile, Stücklisten, Office-Dokumente, Projekte und Anforderungsspezifikationen schnell und effizient zu importieren.
2. Unterstützung verschiedener Dateiformate
CIM Database Cloud unterstützt eine Vielzahl von Dateiformaten und Datenquellen, was den Import von unterschiedlichen Datenobjekten erleichtert. Dazu gehören unter anderem Excel-Dateien, CAD-Formate und das ReqIF-Format für Anforderungsspezifikationen.
3. Automatisierte Validierungsprozesse
CIM Database Cloud verfügt über integrierte Validierungsmechanismen, die dabei helfen, potenzielle Fehler während des Importprozesses zu erkennen und zu beheben. Diese Funktionen prüfen während des Imports automatisch, ob die Daten vollständig und konsistent sind, und tragen so zu einer hohen Datenqualität bei.
4. Iterativer Migrationsansatz
Die Plattform unterstützt einen iterativen Migrationsansatz, bei dem Sie Daten schrittweise importieren und testen können. So erkennen und beheben Sie potenzielle Probleme frühzeitig, ohne dass der Migrationsprozess beeinträchtigt wird. Dies reduziert das Risiko von Fehlern und beschleunigt die Datenmigration.
5. Detaillierte Dokumentation und Support
Begleitend zum Migrationsprozess bietet CIM Database Cloud eine umfangreiche Dokumentation und Tutorials. Diese enthalten klare Anleitungen und Beispiele, wie Sie verschiedene Datentypen importieren und konfigurieren können. Zusätzlich stehen Ihnen Customer Success Manager*innen zur Seite, die Sie bei Bedarf unterstützen.
Fazit
Die Migration von Daten in Cloud-basierte PLM-Systeme ist häufig mit vielen Herausforderungen verbunden. Eine erfolgreiche Datenmigration erfordert daher eine sorgfältige Planung, die Aspekte wie Datenqualität, Umfang, Strukturunterschiede und Sicherheitsanforderungen berücksichtigt.
CIM Database Cloud bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre PLM-Daten effizient zu migrieren und Ihre Produktentwicklungsprozesse zukunftssicher zu gestalten. Durch benutzerfreundliche Import-Tools, die Unterstützung verschiedener Datenformate, automatisierte Validierungsprozesse und eine umfangreiche Dokumentation können Unternehmen ihre bestehenden Daten nahtlos und sicher integrieren. Ein iterativer Migrationsansatz, gepaart mit einer umfassenden Vorbereitung, minimiert Risiken und sorgt für einen reibungslosen Übergang ins neue System.