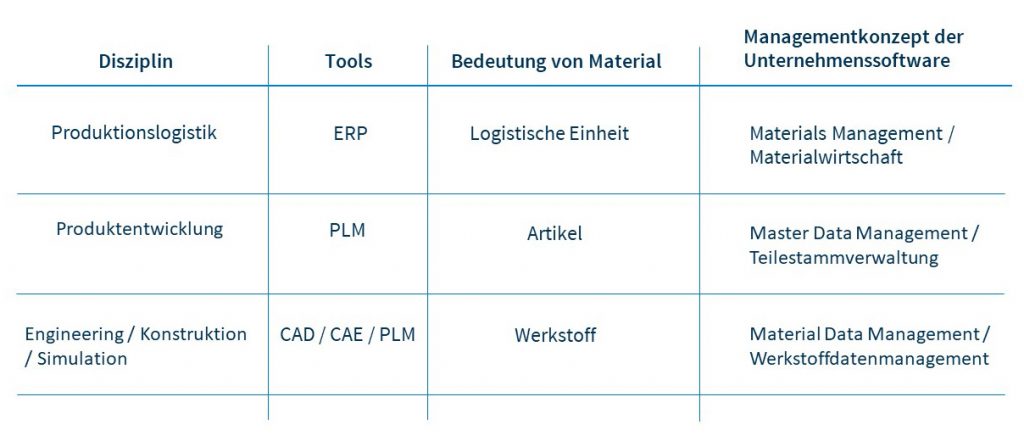Die Digitalisierung von Unternehmensprozessen hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Aufmerksamkeit erfahren. Zum einen legte die Corona-Pandemie digitale Defizite schonungslos offen, zum anderen sind Unternehmen in Anbetracht des politischen, gesellschaftlichen und ökologischen Wandels mehr denn je gefordert, agiler und nachhaltiger zu handeln. Motivation ist also ausreichend vorhanden und die Fortschritte in der Digitalisierung werden mehr und mehr sichtbar. Die Umsetzung erfolgt dabei jedoch meist weniger anhand einer Digitalisierungsroadmap, die die Meilensteine und Wegpunkte bis zum Ziel aufzeigt, sondern eher nach der sprichwörtlichen Salamitaktik.
Häppchenweise Digitalisierung birgt Risiken
Wenn ich mit Vertretern mittelständischer Unternehmen über das Thema Digitalisierung spreche, lautet die Antwort häufig: Ja, das machen wir laufend! Als Beispiele folgen dann unter anderem Maßnahmen wie die Erstellung von Policies zur unternehmensweit stärkeren Nutzung der Features von Office-Software, die Einführung eines Tickesytstems oder die Nutzung eines Requirements Management Tools in der Produktentwicklung.
Dies spiegelt die weit verbreitete Praxis wider, Digitalisierungsprojekte bereichs- oder abteilungsweise, bezogen auf einzelne Aufgabenstellungen oder Teilprozesse durchzuführen. Es scheint auf den ersten Blick oft attraktiv, Projekte aus Bereichs- oder Standortsicht zu planen und umzusetzen, denn der Abstimmungsaufwand ist geringer und bereichsspezifische Lösungen können vermeintlich schnell umgesetzt werden.
Grundsätzlich ist die Durchführung anspruchsvoller Projekte in überschaubaren Schritten eine sinnvolle Vorgehensweise. Schnell Nutzen zu erzeugen und Digitalisierungsfortschritte kontinuierlich sichtbar zu machen, ebenfalls. Allerdings birgt das fragmentierte Vorgehen auch Risiken: Dann nämlich, wenn das Zielbild der Digitalisierung unklar und der Weg dorthin nicht ausreichend beschrieben ist. Hier besteht die realistische Gefahr, wesentliche Ziele von Digitalisierungsprojekten nicht zu erreichen. Wie zum Beispiel die Potenziale neuer, digitaler Geschäftsmodelle nicht auszuschöpfen und damit die digitale Transformation des Unternehmens nicht voranzutreiben. Oder die unternehmensweiten und unternehmensübergreifenden Datenschätze nicht zu nutzen, wenn der Fokus nur auf lokalen Optimierungen liegt.
Die Vorteile einer Digitalisierungsroadmap
Um es vorwegzunehmen: Mit einer Roadmap zur Digitalisierung können Unternehmen die oben genannten Risiken mit wenig Aufwand minimieren. Sie bietet eine verlässliche, mittelfristige Guideline für alle Digitalisierungsaktivitäten im Unternehmen, ausgerichtet auf ein klares Zielbild. Mit ihren unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Digitalisierung adressiert sie sowohl die Fachabteilungen, die IT als auch das Management. Dabei sollte die Digitalisierungs-Roadmap einige wesentliche Informationen beinhalten:
- Welchen Digitalisierungsgrad hat das Unternehmen?
Die Basis der Digitalisierungsroadmap bildet die Bestandsaufnahme des aktuellen Digitalisierungsgrades im Unternehmen. Dazu werden die bereits bestehenden Zielbilder, Anforderungen und Aktivitäten in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen und -hierarchien gesichtet. Gängige Reifegradmodelle helfen, den Digitalisierungsgrad des Unternehmens einzuschätzen. - Was ist das Zielbild?
Steht das Status quo fest, kann ein klares, abgestimmtes Zielbild der Digitalisierung entworfen werden. Das Zielbild enthält einen Überblick über die zukünftigen digital durchgängigen Geschäftsprozesse sowie die zukünftige Applikationsarchitektur und die notwendigen Informationsservices. - Welche Teilschritte sind nötig?
Ist das Ziel klar geht es darum, die dafür notwendigen Teilprojekte zu definieren und zu beschreiben. Um die Teilprojekte sinnvoll zu priorisieren, werden die benötigten internen und externen Ressourcen sowie die möglichen Projektrisiken abgeschätzt. Mit den zuvor gewonnenen Informationen aus der Bestandsaufnahme wird zudem das Nutzen- und Geschäftspotenzial der einzelnen Digitalisierungs-Teilprojekte hochgerechnet. Damit ist die Berechnung von Business Cases der geplanten Projekte möglich.
Projektteam und Management sind so in der Lage, über die Teilprojekte und ihre Priorisierung nach objektiven Kosten-/Nutzenkriterien, Ressourcenverfügbarkeit und anderen unternehmens-spezifischen Parametern zu entscheiden. So werden die heutigen Digitalisierungshäppchen zu definierten, bewerteten Teilprojekten innerhalb eines übergreifenden Kontexts. - Wie sieht der Business Case aus?
Der hohe Konkretisierungsgrad der Digitalisierungsaktivitäten, speziell des aussagekräftigen Business Cases, schafft eine wesentliche Voraussetzung für eine belastbare Finanzierung der Digitalisierungsprojekte. So bieten zum Beispiel spezielle IT-Projektfinanzierer ein flexibles Aufstockungsleasing an, das die Leasingraten an den zu erwartenden Nutzenaufwuchs anpasst. Oder auch die Finanzierung der internen Personalressourcen. Mit solchen Finanzierungsmodellen gelingt die Digitalisierung dann sogar ohne Einschränkungen der Liquidität.
Fazit
In der Vergangenheit wurden häufig nur einzelne Vorhaben gestartet. Aktuell nutzen jedoch immer mehr unserer Kunden die Vorteile der strategischen Planung mit Digitalisierungsroadmaps. Sie bieten mit wenig Aufwand eine verlässliche Orientierung für die Digitale Transformation mit einem klaren Zielbild, konkretem Business Case und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten.