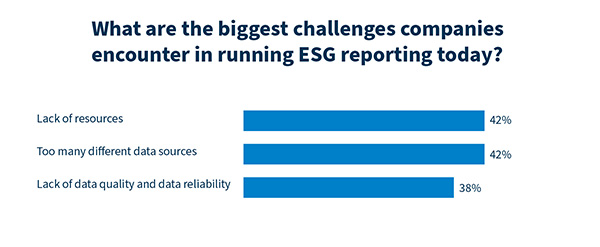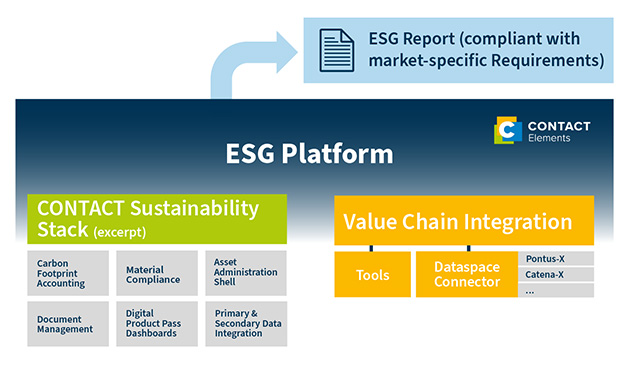Was haben Klimawandel, pandemische Entwicklungen und statistische Gefahren mit den Auswirkungen einer digitalen Transformation auf die Menschen einer Organisation gemeinsam? Kurze Antwort: Es gibt einen nachweisbaren menschlichen Hang, komplexe oder abstrakte Risiken zu ignorieren oder zu unterschätzen. Und was hat organisatorisches Change Management damit zu tun? Das will ich Ihnen in folgendem Blogbeitrag erläutern.
Ein bekanntes Beispiel für statistische Gefahren sind Einflüsse von Bewegungsmangel, Nikotin oder Alkohol auf die damit wachsende Gefahr von Herz-/Kreislauferkrankungen. Organisationen in der Umsetzung einer digitalen Transformation laufen in ein 70% Risiko, dass diese scheitert. Wo ist der Zusammenhang?
Es gibt in beiden Beispielen anerkannte und hilfreiche Lösungen das statistische Risiko zu minimieren. Bei dem Thema digitale Transformation ist das die konsequente Anwendung von organisatorischem Change Management. Es reicht nicht aus, technisch und methodisch perfekt aufgestellt zu sein. Der Faktor Mensch – als Adressat der Veränderung – muss zusätzlich im Fokus stehen.
Was ist organisatorisches Change Management?
Organisatorisches Change Management ist ein systematischer Ansatz. Es steuert aktiv die menschliche Seite von Veränderungen in einer Organisation. Dies umfasst eine Reihe von Prozessen, Technologien oder Strategien, um die Menschen bei Veränderungen zu begleiten und so das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
„Manager schätzen, dass 69 % aller Transformationen aufgrund unzureichenden Change Managements scheitern.“
– Change Management Compass 2023, Porsche Consulting
Kennen wir alles schon
In der praktischen Beratung erlebe ich das häufig. Anekdotische oder psycho-edukative Beispiele helfen, eigene Erfahrungen als Erinnerung an ähnliche Situationen zu aktivieren. Oft gibt es Reaktionen wie „das ist bei uns auch so“ oder „an so eine Projektsituation kann ich mich auch erinnern“.
Das ist der spannende Moment. Wenn es plötzlich klick macht und Zusammenhänge in ganz neuem Licht erkannt werden. Dazu zwei Beispiele:
1. Unklare Richtung
In einem Fall war es die formulierte Vision eines Veränderungsprogramms: 8% EBITA-Steigerung. Jedoch war es den Beschäftigten in der praktischen Arbeit nicht verständlich, wie sie durch ihre Arbeit direkt oder indirekt auf diese Vision, die eher ein metrisches Ziel darstellt, einzahlen.
Die Mitarbeiter*innen hatten keine Vorstellung darüber, wann das wie gemessen würde, was danach kommt und was das für die einzelne Person bedeutet. Dies gilt auch für die Konsequenzen einer Unter- oder Überschreitung. Im Ergebnis also eine eher ungeeignete Vision, eine Richtung vorzugeben.
Nie ist es nur ein einzelner fehlender Aspekt. Es sind mehrere unterschätzte oder missverstandene Situationen und Maßnahmen, die das Ergebnis in der Summe weit ungünstiger beeinflussen, als man es ihnen in der einzelnen Betrachtung ansehen würde.
2. Fehlendes Sponsorship
Grundlegend für die Bereitschaft zur Unterstützung eines Veränderungsprojektes ist Verständnis. Die Mitarbeiter*innen müssen erkennen, dass diese Veränderung wichtig und dringlich ist und dass die Konsequenzen durch Ignorieren dieser Tatsache wirklich zu vermeiden sind.
Teil dieses Verständnisses ist, dass diese Situation selbstverständlich eine entsprechende Management Attention hat. Es muss also jemand am Steuer stehen, der aktiv und mit viel Engagement um diese Klippe herumsteuert.
Die häufigsten drei Missverständnisse zum Thema Sponsorship, die mir in Projekten begegnet sind:
- Das Top Management nimmt seine Sponsorenrolle ausschließlich hinter verschlossenen Türen im Steuerkreismeeting wahr. Ergebnis: Keiner erkennt, ob jemand lenkt.
- Die Verantwortung für die Veränderung wird in eine Führungsebene delegiert, in der nicht die erforderliche Entscheidungsbefugnis existiert. Ergebnis: Jemand bekommt ein Paddel in die Hand und soll den Tanker damit auf Kurs bringen.
- Das Thema Sponsorship ist gar nicht formal geklärt. Ergebnis: Das Steuerrad dreht sich von allein hin und her.
Unklare Visionen und fehlendes Sponsorship sind nur zwei von mehreren Top-Treibern für fehlgeleitete Veränderungsprojekte.
Eine Gemengelage, in der Skepsis und Ablehnung gären
Das menschliche Gehirn vervollständigt offene Muster völlig automatisch. Wo Absichten intransparent sind, Informationen fehlen und die eigene Position auf dem Spielfeld der Veränderung unklar bleibt, werden fehlende Teile durch eigene Interpretationen und Erklärungen ergänzt und über den schnellsten Kommunikationskanal einer Organisation – den Flurfunk – ausgetauscht und untereinander auf Plausibilität geprüft. Ideen für eine bessere Lösung, die Sorge, nicht mehr als Experte zu gelten oder um den Verlust von Sicherheit im Umgang mit den bekannten Prozessen und Werkzeugen, die Überzeugung, es könne noch ein gutes Stück so weitergehen wie bisher. Themen wie Wertschätzung, Perspektiven für die Zukunft und Angst vor Jobverlust sind prominent.
Um es an dieser Stelle ein wenig abzukürzen: Wir Menschen mögen keine Veränderungen. Wir geben uns häufig sogar viel Mühe, den Status quo zu erhalten oder ihn wieder herzustellen.
Welche Rolle spielt organisatorisches Change Management?
Im Kern sind die drei Hauptziele:
- Die Steigerung der Annahmegeschwindigkeit (Adoption) durch beschleunigte Nutzerakzeptanz und Reduzierung von Widerständen gegen neue Lösungen oder Arbeitsweisen.
- Die Maximierung der Nutzung durch Sicherstellung, dass Menschen neue Werkzeuge, Prozesse oder Systeme konsequent und effektiv nutzen, anstatt in alte Verhaltensweisen zurückzufallen.
- Die Optimierung des Effizienzniveaus, indem Nutzer*innen befähigt werden, mit neuen Lösungen auf produktive Weise zu arbeiten und das volle Potenzial der Transformation umzusetzen.

Mit organisatorischem Change Management zum Erfolg
Der Mensch ist ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation. Organisatorisches Change Management ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Umsetzung eines Veränderungsprojektes. Es stellt sicher, dass technologische Investitionen ihren beabsichtigten Wert liefern.
Wie Sie mir sicher zustimmen, gibt es durchaus Parallelen von Klimawandel, pandemischen Entwicklungen und statistischen Gefahren zu den Auswirkungen einer digitalen Transformation auf die Menschen einer Organisation: Je abstrakter und komplexer eine Gefahrenlage oder ein Risiko ist, desto stärker neigen Menschen dazu, diese Umstände zu unterschätzen oder gar zu ignorieren. Um gravierende Risiken menschlicher Faktoren für die digitale Transformation zu minimieren, ist die konsequente Integration von organisatorischem Change Management unerlässlich.