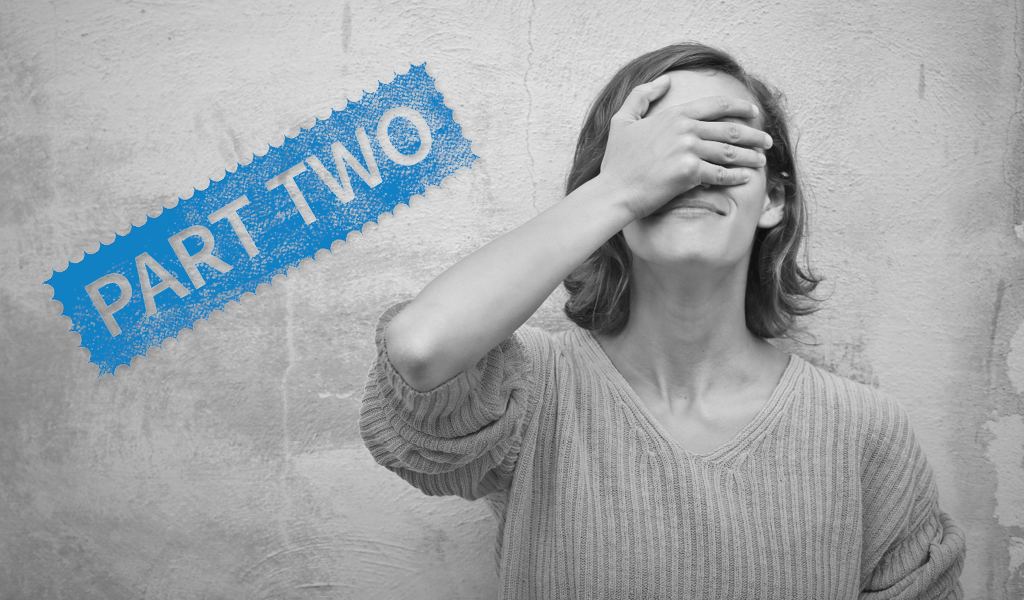Das Internet der Dinge (IoT) und der digitale Zwilling sind in aller Munde – bilden sie doch den Rahmen für neue, digitale Geschäftsmodelle. Laut einer Prognose von PwC beschert die Digitalisierung dem produzierenden Gewerbe in den nächsten 4 Jahren ein Umsatzplus von mehr als 270 Milliarden Euro allein in Deutschland.
Unternehmen erhoffen sich durch smarte Produkte und digitale Geschäftsmodelle Umsatzwachstum. Das bestätigt auch unsere aktuelle IoT-Studie, die gemeinsam mit dem Fraunhofer IPK und dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) durchgeführt wurde. Sie zeigt, dass Unternehmen große Erwartungen haben, verdeutlicht aber gleichzeitig, dass bei der konkreten Umsetzung noch Zurückhaltung herrscht. Viele Unternehmen stehen vor der Frage: „Wie funktioniert das eigentlich mit IoT?“.
Meiner Erfahrung nach machen Unternehmen gedanklich häufig den zweiten vor dem ersten Schritt, was zu Zurückhaltung führt. Natürlich ist es gut und wichtig eine Vision zu haben. Das Bild, was oft in Blogs und Foren veröffentlicht wird, zeigt aber meist sehr weit entwickelte IoT-Szenarien. Sie setzen nicht da an, wo viele Unternehmen aktuell mit ihrem Geschäftsmodell und Technologiewissen stehen.
Darum ist es wichtig, selbst Erfahrungen zu sammeln und sich Schritt für Schritt getreu der Devise Think big, start small, act now! neuen digitalen Geschäftsmodellen anzunähern. Eigene Projekte, auch zusammen mit Technologiepartnern, erweitern den Erfahrungsschatz ganz automatisch. Warum also nicht damit beginnen, die neue Technologie zur Unterstützung des klassischen Geschäfts zu nutzen?
Ich möchte mit meinem Beitrag zeigen, wie Unternehmen in nur 4 Schritten ein effektives IoT-Szenario für ihr Geschäft realisieren können.
Schritt 1: Der digitale Zwilling als Kommunikationsschnittstelle
Die notwendigen Daten für den digitalen Zwilling sind in der Regel bereits im Unternehmen vorhanden. Den Anfang macht eine einfache Seriennummer. Sie dient als Dokumentationsschnittstelle und bringt die Daten mit dem Produkt in Verbindung. Später werden 3D-Daten hinzugefügt. Die Daten liegen häufig bereits in PLM– oder ERP-Systemen vor – zum Beispiel aus der Produktion, dem Einkauf oder der Entwicklung – und sollten zusammenhängend in einem Dashboard abgebildet werden.
Schritt 2: Daten generieren über Sensoren
Auch Sensoren sind bereits häufig vorhanden, beispielsweise für die Steuerung von Geräten, Maschinen und Anlagen. Sie erfassen Zustände wie Leistung, Druck, Verbrauch usw. Diese Daten werden nun konsequent erfasst und geeignet abgelegt. So kann stets der aktuelle Zustand eingesehen werden. Außerdem werden Grenzwerte definiert, zum Beispiel für eine zu hohe Stromabnahme, woraufhin Warnungen versendet und Fehler behoben werden können.
Schritt 3: Smarte Wartungsarbeiten einleiten
Aus der Analyse der Daten lässt sich ein detailliertes Schadens- und Verschleißbild ableiten und Maßnahmen wie Wartungsvorhaben möglichst früh in die Wege leiten. Der digitale Zwilling dient hierbei als Dokumentationsschnittstelle. Alle Anpassungen am Produkt bleiben so nachvollziehbar. Diese Datenhistorie kann später für die Entwicklung von Vorhersagen („Predicitve Maintenance“) verwendet werden. Der digitale Zwilling „as maintained“ unterstützt bei der Dokumentation der Produktänderungen, kann diese mit historischen Daten in Verbindung setzen und somit auch nachweisen, in welcher Konfiguration das Produkt optimal funktioniert. Der klassische Produktlebenszyklus wird also auf die Nutzung erweitert.
Schritt 4: Ersatzteile anfordern
Darüber hinaus werden die Informationen genutzt, um Ersatzteile anzufordern. Mithilfe von komprimierten Service-Stücklisten oder Ersatzteilkatalogen werden die Daten dem betroffenen Bauteil zugeordnet und das benötigte Ersatzteil bei bevorstehendem Schaden zugestellt. Auch diese Daten liegen bereits in ERP-Systemen. Dieser Vorgang kann manuell oder automatisch auf Basis der Gerätemeldungen angestoßen werden. Somit vermeiden Unternehmen Stillstand in der eigenen Fertigung.
In diesen 4 einfachen Schritten ist ein effizientes IoT-Szenario umgesetzt und ein großer Schritt in Richtung digitales Geschäftsmodells gemacht. Ich bin mir sicher, dass vielen Unternehmen so der Start mit der neuen Technologie gelingt.
Also: Loslegen und die gewonnenen Erfahrungen für digitale Geschäftsmodelle nutzen!